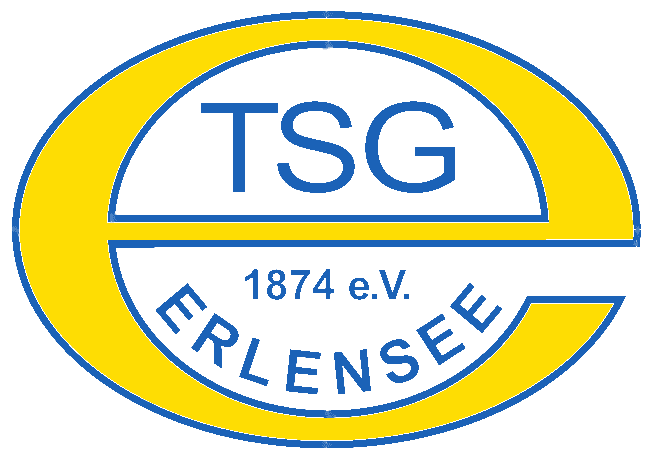Der olympische Winter beginnt: Spiele von Mailand Cortina 2026 eröffnet
Gastgeber Italien feierte den Start der Spiele mit einer Premiere: Erstmals fand die Zeremonie zeitgleich an mehreren Standorten statt. Hauptbühne war das Stadion San Siro in Mailand, parallel wurden in Cortina d’Ampezzo, Predazzo und Livigno weitere Eröffnungsfeiern umgesetzt. Um 23.27 Uhr wurde die olympische Flamme zeitgleich in Mailand und Cortina entzündet. Olympiasieger und Skirennläufer Alberto Tomba sowie Olympiasiegerin und Skirennläuferin Deborah Compagnoni entzündeten die olympische Flamme in Mailand. In Cortina d’Ampezzo übernahm diese Aufgabe Olympiasiegerin und Skirennläuferin Sofia Goggia.
Angeführt vom Fahnenträger-Duo Leon Draisaitl (30/Edmonton Oilers) in Mailand und Katharina Schmid (29/SC Oberstdorf) in Predazzo zog Team Deutschland ein. Insgesamt nahmen 130 Athlet*innen von Team D an den verschiedenen Zeremonien teil. Team Deutschland lief gemäß olympischer Tradition, angeführt von den griechischen Athlet*innen, in alphabetischer Reihenfolge des Gastgeberlandes als 32. Nation hinter Georgien und vor Jamaika ein.
Der Startschuss für Mailand Cortina 2026
Der Countdown geht in den Endspurt! An diesem Freitagabend um 20 Uhr starten mit der Eröffnungsfeier die 25. Olympischen Winterspiele. Gastgeber ist Italien, das die Wettkämpfe über fünf Cluster (Mailand, Cortina d’Ampezzo, Predazzo/Tesero, Livigno/Bormio und Antholz) verteilt.
Rund 3500 Athlet*innen gehen in Norditalien an den Start, deutlich mehr als 2018 in Pyeongchang (Südkorea), das mit 2922 Teilnehmenden bis dato die Bestmarke hält. Nach der Aufnahme von Skibergsteigen sind erstmals acht Sportarten Teil des Olympiaprogramms. In 16 Disziplinen stehen 116 Entscheidungen an. Das Team Deutschland ist mit 185 Athlet*innen vor Ort.
Sportdeutschland hat gewählt: Schmid und Draisaitl tragen die deutsche Fahne
Wie es sich anfühlt, wenn olympische Träume schon vor dem Start der Spiele in Erfüllung gehen, davon können Katharina Schmid und Leon Draisaitl seit diesem Mittwoch berichten. Olaf Tabor, Vorstand Leistungssport im DOSB und Chef de Mission des Team D bei den Winterspielen in Norditalien, informierte die Skispringerin vom SC Oberstdorf und den Eishockey-Topstar von den Edmonton Oilers aus Nordamerikas Profiliga NHL telefonisch darüber, dass sie bei der Eröffnungsfeier am Freitagabend die deutsche Fahne tragen werden. Allerdings - und das ist ein Novum in der olympischen Geschichte - wegen der großen Entfernungen zwischen den Austragungsstätten getrennt. Draisaitl, der am Freitagmorgen aus Kanada einfliegt, wird die deutsche Delegation ins Mailänder Stadion San Siro führen. Schmid trägt die Fahne bei der zeitgleich stattfindenden Eröffnungsfeier in Predazzo.
Die 29-Jährige, die ihre vierten Winterspiele erlebt, war von der Nachricht noch so aufgewühlt, dass sie sich zum Gespräch mit dem DOSB am Telefon mit ihrem Geburtsnamen Althaus meldete. „Ich bin so aufgeregt! Das ist eine riesige Ehre für mich. Wir haben so viele tolle Sportlerinnen und Sportler, und dass ich ausgewählt wurde, ist unglaublich“, sagte sie nach der Ankunft im Olympischen Dorf. Leon Draisaitl erhielt die frohe Kunde am Morgen des „Battle of Alberta“, zu dem er mit seinen Oilers bei den Calgary Flames antrat. „Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Dass mich nicht nur die Fans, sondern auch die Athleten gewählt haben, ist eine riesige Ehre, die mich unfassbar stolz macht“, sagte er.
Die Entscheidung für das Duo fiel in einer gemeinsamen Wahl in der Öffentlichkeit und unter den 185 Athlet*innen des Team D, die vom 26. Januar bis einschließlich 3. Februar lief. An der öffentlichen Wahl beteiligten sich mehr als 135.000 deutsche Fans. Zu den Winterspielen in Peking 2022 waren 120.000 Stimmen aus der Öffentlichkeit abgegeben worden. Die Stimmen aus beiden Gruppen wurden zu je 50 Prozent gewichtet für das Gesamtergebnis gezählt. Die weiteren Kandidat*innen, die zur Abstimmung standen, waren Ramona Hofmeister (29/Snowboard), Laura Nolte (27/Bob), Johannes Rydzek (34/Nordische Kombination) und Tobias Wendl (38/Rennrodeln).
Mailand Cortina 2026: So wohnt Team Deutschland bei Olympia
Die ersten Athlet*innen beziehen aktuell ihre Unterkünfte bei den Olympischen Winterspielen Mailand Cortina 2026. Aufgrund der großen Entfernungen zwischen den Wettkampfstätten setzt das Organisationskomitee auf mehrere Olympische Dörfer und Hotelkomplexe.
„Die Bedingungen im Olympischen Dorf in Cortina sind sehr gut und bieten den Team D Athlet*innen gute Voraussetzungen für die Vorbereitung auf ihre Wettkämpfe. Die Container sind zwar nicht besonders groß, dafür aber gut beheizt und funktional eingerichtet. Die Schneelandschaft und das gemeinsame Leben im Dorf sorgen darüber hinaus für eine besondere olympische Atmosphäre und ermöglichen den Austausch mit Athlet*innen aus anderen Nationen“, berichtet Thomas Arnold, DOSB-Vorstand Finanzen, der im Olympischen Dorf in Cortina untergebracht ist und das Team D Office vor Ort unterstützt.
Wie viele Olympische Dörfer gibt es bei Mailand Cortina 2026?
Bei den Winterspielen 2026 gibt es insgesamt drei offizielle Olympische Dörfer. Ein großes Hauptdorf in Mailand und zwei weitere Dörfer in Cortina d’Ampezzo und Predazzo. In den Wettkampforten Bormio, Livigno sowie Antholz/Anterselva werden zusätzlich mehrere Hotels zu funktionalen Olympischen Dörfern zusammengefasst.
Warum sind die Olympischen Dörfer auf mehrere Standorte verteilt?
Die Wettkämpfe finden über weite Teile in Norditalien statt. Mehrere Dörfer ermöglichen kurze Wege zu den Wettkampfstätten und eine bessere Anpassung an die unterschiedlichen Sportarten. Von Eishockey und Eisschnelllauf bis zu alpinen und nordischen Disziplinen.
Wie viele Athlet*innen wohnen insgesamt in den Olympischen Dörfern?
Rund 1.700 Betten gibt es allein im Olympischen Dorf in Mailand, etwa 950 Athlet*innen aus 41 Nationen wohnen dort, zudem mehrere hundert Betreuer*innen. Das Dorf hat eine Größe von 38.000 m2 - das entspricht rund 21 Eishockeyfeldern.
Im Dorf in Cortina stehen 1.400 Betten in rund 350 Containern zur Verfügung. Hinzu kommen Athlet*innen, die in den Hoteldörfern in Predazzo, Livigno, Bormio und Antholz/Anterselva untergebracht sind.
Die Bedeutung des Leistungssports in Deutschland
Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) begrüßt gemeinsam mit Athleten Deutschland die Veröffentlichung erster Ergebnisse des vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft (BISp) geförderten Forschungsprojekts „Gesellschaftliche Bedeutung des Spitzen- und Leistungssports in Deutschland (GUIDE)“.
Das Projekt untersucht den gesellschaftlichen Nutzen des Spitzen- und Leistungssports in unterschiedlichen Wirkungsfeldern. Im Fokus stehen sowohl die Erwartungen der Bevölkerung als auch empirisch belegbare Wirkungspotenziale. Ziel ist es, vielfach angenommene Effekte, etwa im Hinblick auf Vorbildfunktion, Wertevermittlung, nationale Identifikation oder internationales Ansehen, systematisch und empirisch zu überprüfen.
Das BISp-Projekt leistet damit einen wichtigen Beitrag zu einer evidenzbasierten Auseinandersetzung mit der staatlichen Leistungssportförderung in Deutschland. Bereits im vergangenen Jahr haben Athleten Deutschland und der DOSB im Rahmen einer repräsentativen SINUS-Studie gesellschaftliche Erwartungen an den Leistungssport und die Spitzensportförderung empirisch erheben lassen. Die im Sommer 2025 veröffentlichten Ergebnisse der SINUS-Studie liefern eine differenzierte Bestandsaufnahme der Wahrnehmung des Leistungssports in der Gesellschaft.
Die nun vorliegenden ersten Ergebnisse des BISp-Forschungsprojekts in Form von Fact Sheets ermöglichen es erstmals, diese gesellschaftlichen Erwartungen den empirisch nachweisbaren Wirkungen des Leistungssports gegenüberzustellen. Damit eröffnen sich für alle Stakeholder weitere Diskursräume, die insbesondere im weiteren Prozess rund um das Sportfördergesetz und die geplante Errichtung einer Spitzensportagentur genutzt werden sollten.
Silbernes Lorbeerblatt für Deaflympics und World Games Athlet*innen
81 Athlet*innen haben sich am 4. Februar 2026, auf Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, in das Schloss Bellevue eingefunden. Die Medaillengewinner*innen der World Games in Chengdu sowie der Sommer-Deaflympics in Tokio wurden mit der höchsten sportlichen Auszeichnung der Bundesrepublik Deutschland, dem Silbernen Lorbeerblatt, gewürdigt.
In seiner Ansprache beschrieb der Bundespräsident die besondere Stimmung der Veranstaltung: „Immer nämlich, wenn ich das Silberne Lorbeerblatt an verdiente Sportlerinnen und Sportler aushändigen darf, habe ich das Gefühl, dass eine besondere Atmosphäre entsteht. Dass ein besonderer frischer Wind durch die Räume weht: eine Mischung aus Freude und Leidenschaft, aus Mut und Einsatzbereitschaft, aus Ausdauer und Selbstüberwindung, aus Selbstbewusstsein und Teamgeist, aus Lust am Wettbewerb und aus Wille zum Gewinnen.“
Gemeinsam mit Christiane Schenderlein, Staatsministerin Sport und Ehrenamt, überreichte Frank-Walter Steinmeier die Auszeichnungen und, gerichtet an die Deaflympics Athlet*innen, betonte er: „Solche sportlichen Leistungen und Erfolge sind sicher auch Ermutigung für andere Gehörlose, sich einem Team oder Verein anzuschließen und sich selber sportlich auszuprobieren und herauszufordern. Die erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler der Deaflympics sind ganz gewiss für andere mit dem gleichen Handicap Motivation und vielleicht auch Vorbild. Gerade deswegen sind ihre Erfolge sozusagen doppelt wichtig und Grund zur Freude für uns alle.“
Der Bundespräsident hob den besonderen Stellenwert der World Games hervor und, „umso schöner finde ich, dass in diesen bedeutenden Spielen die deutschen Mannschaften seit Langem so hervorragend abschneiden – und das in vielen, wenn nicht allen ihren Disziplinen. Dieses Mal, in Chengdu, sind sie so im Medaillenspiegel hinter den gastgebenden Chinesen auf dem zweiten Platz gelandet. Aber in der ewigen Tabelle aus allen bisherigen World-Games-Austragungen belegen sie den ersten Platz.“
Mit der Verleihung des Silbernen Lorbeerblattes unterstrich der Bundespräsident die Bedeutung der Deaflympics und der World Games sowie der Werte des Sports wie Fairness, Leistungsbereitschaft, Zusammenhalt und gesellschaftliches Miteinander. (Quelle: Bundespräsidialamt)
Para-Biathletin Anja Wicker ist „Sportlerin des Monats“ Januar
Anja Wicker hat ihre starke Saison eindrucksvoll gekrönt: Neben dem Gewinn des Gesamtweltcups feierte die Stuttgarterin einen viel beachteten Heimsieg im Sprint über 7,5 Kilometer im Nordic-Center Notschrei und sammelte darüber hinaus zahlreiche weitere Podestplatzierungen im Biathlon und im Langlauf. Für diese eindrucksvollen Leistungen wählten die von der Sporthilfe geförderten Athletinnen und Athleten Anja Wicker mit 43,2 Prozent zur „Sportlerin des Monats“ Januar.
Anders als bei Medien- oder Publikumswahlen entscheiden bei der Wahl zur „Sportlerin bzw. zum Sportler des Monats“ ausschließlich Deutschlands beste Nachwuchs- und Spitzenathletinnen und
-athleten. Dadurch erhält die Auszeichnung ihre besondere sportliche Wertigkeit. Zu Beginn eines jeden Monats stellt die Sporthilfe den rund 4.000 geförderten Athletinnen und Athleten drei Kandidatinnen oder Kandidaten zur Wahl, die sich im Vormonat durch herausragende Leistungen empfohlen haben. Die Stimmabgabe erfolgt per Online-Voting.
Anja Wicker setzte sich bei der Wahl gegen das Bobteam Lochner (40,3%) und das Rodel-DuoTobias Wendl und Tobias Arlt (18,7%) durch. Johannes Lochner hatte gemeinsam mit seinem Team eine herausragende Saison mit dem Gewinn der Gesamtweltcups im Zweier- und Viererbob gekrönt und sich zudem zusammen mit Anschieber Georg Fleischhauer den Europameistertitel im Zweierbob gesichert. Wendl und Arlt überzeugten mit dem souveränen Gewinn des Europameistertitels im Doppelsitzer in Oberhof und bauten mit ihrem zweiten Weltcupsieg in Folge die Führung im Gesamtweltcup weiter aus - ein deutliches Ausrufezeichen für die olympischen Wettkämpfe in Mailand und Cortina.
Für ihre herausragenden Leistungen waren die Athletinnen und Athleten von der Athletenkommission im DOSB, von SPORT1 und von der Sporthilfe für die Wahl nominiert worden.
Weltkrebstag 2026: Gemeinsam einzigartig
Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger erhielt im Laufe ihrer Karriere gleich zweimal die Diagnose Krebs und kämpfte sich dennoch zurück an die Weltspitze. Wie es ihr damit erging und wie sie es schaffte wieder zurück in den Spitzensport zu finden, gibt es im aktuellen Podcast „Gesund in Sportdeutschland“ zu hören.
Auch Elena Semechin erhielt mitten in ihrer Karriere die Diagnose Krebs. Ende 2025 wurde die Schwimmern mit dem Sparkassenpreis für Vorbilder im Sport im Rahmen der Veranstaltung „Sportler*in des Jahres“ ausgezeichnet. Sie ist eine Athletin, die mit ihrem unerschütterlichen Willen zeigt, dass eine Krebserkrankung nicht das Ende der Leistungssportkarriere bedeuten muss. Nach Entfernung eines Hirntumors im Alter von 28 Jahren wiederholte sie in Paris bei den Paralympics den Gewinn der Goldmedaille.
Siegeswille und Lebensmut – Ann-Katrin Bergers Geschichte zum Weltkrebstag
Die Nationalspielerin hat zwei Krebserkrankungen hinter sich und spricht offen über ihren Weg durch diese herausfordernde Zeit. Anlässlich des diesjährigen Weltkrebstages am 4. Februar unter dem Motto „United by Unique“ teil sie in Episode 5 der 4. Staffel unseres Podcasts „Gesund in Sportdeutschland“, was ihr Kraft gegeben hat, wie ihr unerschütterlicher Siegeswille sie getragen hat und warum Lebensmut, Vertrauen und innere Stärke für sie entscheidende Schlüssel zur Genesung waren. Eine inspirierende Geschichte, die Hoffnung macht - für Betroffene und alle, die zuhören.
Das sind die beliebtesten Trendsportarten für den Winter
Wintersport ist längst mehr als Skifahren und Rodeln. Neue Sportarten entstehen, getragen von dem Interesse an neuen Sportarten und dem Bedürfnis nach ganzjähriger Fitness. Hinzu kommt: Trends verbreiten sich über Social Media schneller als je zu vor. Wir werfen einen Blick auf die spannendsten Trendsportarten, die den Winter aktuell prägen.
Am Anfang war ein Trend
Was als Nische beginnt, wird schnell zum Trend und birgt das Potenzial zur etablierten Sportart. Im Wintersport fest verankert ist heutzutage das Snowboarden. Die Sportart, welche in den späten 1980er Jahren als rebellische Gegenbewegung und Trendsportart galt, ist heute nicht mehr von den Skipisten wegzudenken und sogar fester Bestandteil der Olympischen Winterspiele.
Skitourengehen/Skimo
Bei den Olympischen Winterspielen in Mailand Cortina 2026 erstmals dabei ist das Skibergsteigen (Skimo). Die schnelle, konditionell höchst anspruchsvolle Sportart ist die als Wettkampf ausgetragenen Form des Skitourengehens. Skitourengehen erlebt in den letzten Jahren als Leistungssport, wie auch als Freizeitsport eine echte Renaissance. Da Skitourengehen sowohl einiges an Kondition als auch an Erfahrung benötigt, hat der Deutsche Alpenverein (DAV) alles aufgelistet, was ihr wissen müsst: Skitourengehen: Varianten und Überblick | Bergsport im Winter | DAV
Digitalisierung und KI im Sport - Innovation mit Verantwortung
Digitalisierung und Künstliche Intelligenz sind längst im Sport angekommen. Sie prägen Trainingsmethoden, Organisationsstrukturen und Verwaltungsprozesse im Breiten- wie im Leistungssport. Gleichzeitig wachsen die Anforderungen an Transparenz, Datenschutz und ethische Verantwortung. Eine zentrale Frage ist: Kann Fortschritt und Innovation gelingen bei gleichzeitiger Wertebewahrung?
„Der Wandel ist sehr heterogen“
Der organisierte Sport in Deutschland ist historisch gewachsen und entsprechend vielfältig aufgestellt. Die mehr als 86 Tausend Sportvereine sowie die Sportverbände und Landessportbünde unterscheiden sich stark in Größe, Struktur und Ressourcen. Entsprechend verschieden ist auch der Stand der Digitalisierung. Während einige Organisationen bereits datenbasiert arbeiten und digitale Plattformen nutzen, stehen andere noch am Anfang. „Doch der Austausch und die Kooperation wachsen“, berichtet Morten Pohl, Prozessmanager Digitalisierung und KI beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB). „Beides ist enorm wichtig, denn durch den inhaltlichen Austausch verbreiten sich erfolgreiche Konzepte und ersparen vor allem im Ehrenamt wertvolle Arbeitszeit.“
Chance für den Breiten- und Leistungssport
Die Potenziale von Digitalisierung und KI zeigen sich je nach Bereich unterschiedlich. Im Leistungssport ermöglichen datenbasierte Anwendungen eine präzisere Trainingssteuerung, gezielte Talententwicklung und verbesserte Verletzungsprävention.
Im Breitensport hingegen stehen andere Ziele im Vordergrund: organisatorische Entlastung, niedrigere Zugangshürden und nutzerfreundliche digitale Angebote. Genau hier setzt Matthias Hübner an. Als Leiter der Digitalisierung bei SPORTDEUTSCHLAND verantwortet er zentrale Digitalprojekte im organisierten Sport. „Was wir im Breitensport beobachten, ist eine große Vielfalt an digitalen Lösungen“, sagt Hübner. „Erfolg stellt sich dann ein, wenn wir Standards schaffen, Kooperationen stärken und alle Beteiligten aktiv einbinden.“
Olympische Winterspiele 2026: So steht es um das deutsche Medaillenpotenzial
Ihr kennt es alle: Wenn Olympische Spiele anstehen, ist Orientierung wichtig. Wo sehe ich wann was, welches sind die Wettbewerbe, die aus deutscher Sicht besondere Aufmerksamkeit verdienen? Da in Norditalien die Wettkämpfe auf fünf Cluster aufgeteilt sind, wird das Ganze noch ein wenig komplizierter. Um für ein wenig Durchblick zu sorgen, haben wir Robert Bartko, im Geschäftsbereich Leistungssport des DOSB Leiter für Verbandsberatung und Sportförderung, um eine Potenzialeinschätzung gebeten. Der 50-Jährige, der als aktiver Bahnradsportler bei den Sommerspielen 2000 in Sydney (Australien) zwei Goldmedaillen gewinnen konnte, legt Wert darauf, dass es sich bei der Analyse, die auf Basis der Daten des Statistiksystems Gracenote erstellt wird, um genau das handelt: das Medaillenpotenzial, das nicht mit einer Vorgabe oder Erwartung gleichgesetzt werden sollte.
Das ausgegebene sportliche Ziel für das 185 Athletinnen und Athleten (99 Männer, 86 Frauen) umfassende Team D lautet, den Platz unter den Top-drei-Wintersportnationen der Welt zu behaupten, der vor vier Jahren in Peking mit Rang zwei im Medaillenspiegel untermauert werden konnte. „Hinter Norwegen und den USA sehen wir Team D in einem harten Wettbewerb mit Frankreich und den Niederlanden. Es kann durchaus sein, dass mehr Medaillen für uns möglich sind als die 27 in Peking, aber erneut zwölf goldene wie 2022 zu gewinnen, wird sehr schwierig. Gleichwohl glauben wir aber fest daran, dass die Top drei ein ambitioniertes Ziel, aber keinesfalls unerreichbar sind“, sagt Robert - der als ehemaliger Hochleistungssportler natürlich weiß, dass ambitionierte Ziele wichtig sind.
In Cortina stehen Bob, Rodeln, Skeleton, Curling, Ski alpin der Frauen an
Beginnen wir unsere Italien-Reise also in einem der beiden Hauptorte. Cortina ist für das Team Deutschland so etwas wie die Zentrale, hier ist das Deutsche Haus angesiedelt, in dem traditionell Medaillenerfolge gemeinsam gefeiert werden. Der Standort wurde mit Bedacht gewählt, schließlich befindet sich in Cortina auch der Eiskanal. „Bob, Rodeln und Skeleton sehen wir auch in diesem Jahr als Medaillengaranten, die Basis für unser Gesamtergebnis wird dort gelegt werden“, sagt Robert. In die Bewertung fließen natürlich die Vorergebnisse der laufenden Weltcupsaisons ein - und die lassen darauf schließen, dass im Bob und Rodeln Deutschland ganz eindeutig die dominierende Nation sein dürfte. „Natürlich haben Olympische Spiele ihre eigenen Gesetze, aber wenn man sieht, dass wir im Viererbob der Männer drei gleichwertige Teams haben, die im Zweier genauso dominant unterwegs sind, dazu bei den Frauen ebenfalls bestens aufgestellt sind, dann dürfen wir dort einiges erwarten.“
Ähnlich sieht es im Rodeln aus, wo sich aber doch manches Mal eine andere Nation aufs Podium drängen konnte. „Auch dort haben wir aber realistische Chancen, alle Wettbewerbe zu gewinnen“, sagt Robert. Nicht ganz so erdrückend ist die deutsche Dominanz im Skeleton, wo 2022 beide Goldmedaillen in den Einzeln an Deutschland gingen. „Medaillenchancen bestehen dennoch überall, in der Mixedstaffel ist Gold am wahrscheinlichsten.“
In Cortina wird allerdings nicht nur im Eiskanal, sondern auch auf der Eisfläche performt. Das Curling-Turnier der Männer ist erstmals seit 2014 wieder mit einem deutschen Team besetzt. „Für den Verband war die Qualifikation sehr wichtig, und grundsätzlich ist es immer schön, wenn die Teamsportarten besetzt sind. Eine Platzierung zwischen vier und acht ist für die Mannschaft um Skip Marc Muskatewitz realistisch“, sagt Robert.
Ein weiteres Highlight sind in Cortina die alpinen Skirennen der Frauen. „Unsere Statistik sieht eher keinen Medaillengewinn vor, aber insbesondere Emma Aicher hat gezeigt, dass mit ihr in allen Disziplinen zu rechnen ist. Wenn sie einen guten Tag erwischt, ist sicherlich alles möglich“, sagt Robert. Gleiches gelte für die Männer, die ihre Rennen in Bormio absolvieren. „Dort ist am ehesten Linus Straßer im Slalom ein Medaillenkandidat, der über viel Erfahrung verfügt und schon oft bewiesen hat, dass er für das Podium gut sein kann.“
Bormio begrüßt die neue olympische Sportart Skibergsteigen
Bormio wird gemeinsam mit Livigno als ein Cluster gerechnet. Neben den Alpinen sind in Bormio noch die Skibergsteiger am Start, die ihre Olympiapremiere feiern dürfen. „Hier haben wir keine Vergleichswerte zu 2022, aber die Prognose sagt, dass die besten Chancen auf Edelmetall in der Mixedstaffel bestehen, zu der eine Frau und ein Mann gemeinsam antreten. Im Einzel, wo wir mit Helena Euringer, Tatjana Paller und Finn Hösch an den Start gehen, wäre eine Top-acht-Platzierung schon ein großartiges Ergebnis“, sagt Robert.
Livigno ist die Heimat der „jüngeren“ Sportarten, Snowboard und Ski Freestyle werden hier ein großes Publikum begeistern. Vor einer Athletin zieht Robert schon vor dem Start den Hut. „Ramona Hofmeister drohte wegen einer Knöchelverletzung aus dem September die Spiele zu verpassen, dann hat sie sich rechtzeitig für die Qualifikation mit zwei Weltcupsiegen zurückgemeldet. Sie hat viel Erfahrung und gilt im Parallel-Riesenslalom als wichtigste Medaillenkandidatin“, sagt er. Grundsätzlich wünscht er dem gesamten Team von Snowboard Germany, „dass sie die Leistungen, die sie regelmäßig im Weltcup bringen, endlich auch beim Saisonhöhepunkt abrufen, da fehlt noch ein wenig der Durchbruch.“ Die Prognosen ergeben viele Platzierungen zwischen Rang vier und acht.
Bei den Ski-Freestylern liegen die Hoffnungen im Skicross auf Daniela Maier und Florian Wilmsmann, „zwei erfahrenen Leuten, die das Potenzial haben, nach vorn zu fahren. Allerdings ist Skicross wegen der Dynamik des Wettkampfs unglaublich schwer zu prognostizieren“, sagt Robert. In der Halfpipe (Sabrina Cakmakli), im Big Air (Muriel Mohr) und bei den Aerials (Emma Weiß) sind drei Sportlerinnen qualifiziert, die an einem rundum guten Tag ebenfalls in Richtung Medaillenränge schauen könnten.
Der Stellenwert der Krebsprävention wächst
Expert*innen gehen davon aus, dass rund 40 Prozent aller Krebserkrankungen durch eine gesunde Lebensweise vermieden werden könnten. Im Mittelpunkt steht dabei der initiierte Präventionsgipfel der Deutschen Krebshilfe und des Deutschen Krebsforschungszentrums, auf dem fünf zentrale Handlungsempfehlungen an die Politik vorgestellt wurden, um die Wirksamkeit der Krebsprävention bundesweit zu stärken. Flankierend dazu wird in Heidelberg ein Krebspräventionszentrum aufgebaut. Als nationales Netzwerk soll es Präventionsforschung, Früherkennung und Versorgung enger miteinander verzahnen. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2027 vorgesehen (Quelle: Deutsche Krebshilfe).
Initiative "Bewegung gegen Krebs"
"Prävention endet nicht bei Strategien und Empfehlungen, sie braucht Orte, an denen sie gelebt wird. Genau hier setzt der organisierte Sport an", sagt Jakob Etzel, zuständiger Referent im DOSB. Im Rahmen der Initiative „Bewegung gegen Krebs“ von Deutscher Krebshilfe und DOSB konnten im vergangenen Jahr wichtige Impulse gesetzt werden. Mit der erstmals durchgeführten Vereinschallenge wurde ein neues Format erfolgreich etabliert. 83 Vereine sammelten gemeinsam rund 380.000 „Bewegungsminuten“. Aufgrund der großen Resonanz wird die Vereinschallenge auch in diesem Jahr fortgeführt. Darüber hinaus ist „Bewegung gegen Krebs“ erneut auf zahlreichen Veranstaltungen präsent, darunter Fachkongresse im Frühjahr wie der Deutsche Krebskongress und der Kongress Armut und Gesundheit. Im Sommer werden erstmals „Die Finals“ in Hannover, einem der größten Multisportveranstaltungen Deutschlands, angesteuert.
Silber strahlt am Ende eines überragenden Turniers
Sie haben alles gegeben, haben dem Weltmeister und Olympiasieger einen überragenden Kampf geliefert, aber am Ende war Dänemark doch zu stark für die deutschen Handballer. Nachdem die Auswahl des Deutschen Handballbunds bei der Europameisterschaft in Dänemark, Norwegen und Schweden zuvor Topnationen wie Frankreich, Spanien, Norwegen und im Halbfinale Kroatien geschlagen hatte, gab es am Ende Silber nach der 27:34-Finalniederlage gegen die Dänen, die nun alle drei großen Titel des Welthandballs (EM, WM, Olympia) gleichzeitig innehaben. Bundeskanzler Friedrich Merz, der zum Endspiel ins dänische Herning gereist war, klatschte Beifall, besuchte die Mannschaft nach der Medaillenzeremonie in der Kabine und unterhielt sich 20 Minuten mit den Spielern. „Was für ein Finale, was für eine starke Europameisterschaft. Ihr habt gekämpft, Nervenstärke und Teamgeist gezeigt“, schrieb Merz in den Sozialen Medien: „Ich gratuliere Dänemark zum Titel und den deutschen Handballern zum zweiten Platz und zu einem überzeugenden Turnier. Wir sind stolz auf euch.“
Vor allem dank der 14 Paraden von Andreas Wolff, der im Finale Deutschlands EM-Rekordspieler mit 42 Partien wurde und zudem der erste deutsche Handballer ist, der zum dritten Mal in einem EM-All-Star-Team steht, konnte die DHB-Auswahl lange Zeit vom ersten EM-Titel seit 2016 träumen. Selbst die frühe Rote Karte gegen Tom Kiesler nach 13 Minuten warf die Deutschen nicht aus der Bahn, der finale Schock war dann aber die zweite Rote Karte gegen Jannik Kohlbacher drei Minuten vor dem Ende. Deutschland kämpfte sich dank der Tore von Juri Knorr und Julian Köster nach dem 7:10 wieder zurück, war bis zum 27:29 in der 53. Minute auf Augenhöhe, dann aber zog ihnen Torwart Kevin Möller den Zahn - und das während der gesamten EM überragende Rückraum-Duo Simon Pytlick und Mathias Gidsel entschied, mal wieder, die Partie.
Neben Wolff (THW Kiel) hatte sich Kreisläufer Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt) seinen All-Star-Team-Status wahrlich verdient. Für Golla war es das zweite Mal nach 2022. Auch wenn die Finalniederlage nach 50 ausgeglichenen Minuten absolut schmerzte, zogen Spieler und Bundestrainer Alfred Gislason ein positives Turnierfazit: „Dänemark hat den Sieg absolut verdient und ist verdientermaßen Europameister. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Mannschaft und wie die Jungs während des gesamten Turniers gespielt haben. Das Team hat sich mit jedem Spiel gesteigert. Aber Dänemark ist unglaublich. Ich finde, das Ergebnis ist im Vergleich zum Spielverlauf etwas hoch. Wir haben alles getan, um die Goldmedaille zu gewinnen“, sagte Gislason.
Zusammenhalt und Erfolgshunger sollen die deutschen Eishockey-Frauen tragen
Mit sportlichen Prognosen ist das immer so eine Sache. Man weiß ja nie genau, wie die Konkurrenz wirklich in Form ist, ob die eigene Vorbereitung ausreichend war und welchen Einfluss äußere Faktoren haben werden. Eins jedoch kann Jeff MacLeod mit Sicherheitsgarantie versprechen: „Wir werden eine deutsche Mannschaft sehen, die mit 100 Prozent Erfolgshunger und Einsatzwillen an die Arbeit geht“, sagt der Bundestrainer der Eishockey-Frauen vor dem Start des Olympiaturniers. Das mag zwar wie eine Binsenweisheit klingen, aber für den 54 Jahre alten Kanadier sind es genau jene Dinge, die sein Team auszeichnen. „Wir haben eine menschlich herausragende Gruppe, in der sich alle aufeinander verlassen können. Wir sind wie eine Familie, und ich bin überzeugt davon, dass uns dieser Zusammenhalt weit bringen kann“, sagt er.
Zumindest haben diese Qualitäten dazu geführt, dass erstmals seit Sotschi 2014 wieder deutsche Frauen das olympische Eishockeyturnier bereichern. Und weil dieses bereits am Donnerstag und damit einen Tag vor der offiziellen Eröffnung der Winterspiele in Norditalien beginnt, erfährt MacLeods Auswahl, die sich ihr Olympiaticket beim letzten Qualifikationsturnier in Bremerhaven Anfang vergangenen Jahres sicherte, eine doppelte Wertschätzung. Nicht nur, weil sie die Medaillenkämpfe mit der Partie gegen Schweden um 12.10 Uhr in der Rho Arena in Mailand eröffnet; sondern auch, weil die Spielerinnen um Kapitänin Daria Gleißner (32/Memmingen Indians) damit die ersten Deutschen sind, die den Wettkampfbetrieb aufnehmen. „Natürlich ist das für uns eine besondere Ehre, die Vorfreude ist riesig“, sagt Angreiferin Emily Nix.
Emily Nix trifft gegen Schweden auf drei Vereinskolleginnen
Für die 28-Jährige, die in Hamburg aufwuchs und als Sechsjährige auf einer öffentlichen Eisbahn im Park Planten un Blomen entdeckt wurde, ist das Duell mit den Skandinavierinnen zusätzlich brisant. Die Stürmerin spielt im Ligabetrieb für Frölunda HC in Schweden. „Ich treffe direkt auf drei Mitspielerinnen aus dem Verein, das ist natürlich besonders, da wollen wir es uns gegenseitig noch einmal extra zeigen“, sagt sie. Das ZDF wird die Partie live übertragen, die Augen der deutschen Sportfans dürften exklusiv auf die Eishockeyfrauen gerichtet sein. „Für uns ist das eine großartige Chance, unseren Sport in ein gutes Licht zu stellen und noch bekannter zu machen. Diese Chance wollen wir unbedingt nutzen“, sagt Emily Nix.
Der Modus im Frauenturnier ist gewöhnungsbedürftig. In Gruppe A spielen die fünf besten Teams der Weltrangliste - USA, Kanada, Finnland, Tschechien, Schweiz - gegeneinander, alle fünf erreichen aber sicher das Viertelfinale. In Gruppe B muss sich Deutschland nach dem Duell mit Schweden noch mit Japan (7. Februar, 12.10 Uhr), Frankreich (9. Februar) und Gastgeber Italien (10. Februar, beide 16.40 Uhr) auseinandersetzen, die besten drei Teams stehen in der Runde der letzten acht. Schweden wird als der härteste Gruppengegner eingeschätzt. „Ich finde es gut, gleich gegen sie zu spielen, dann sind wir sofort voll drin im Turnier und wissen, wo wir stehen“, sagt Emily Nix. Zwar schaue man im Team nur von Spiel zu Spiel, der Gruppensieg wäre jedoch für den weiteren Turnierverlauf die beste Grundlage. „Und natürlich wollen wir jedes Spiel gewinnen, sonst müssten wir doch nicht anreisen“, sagt die Hamburgerin.
Jeff MacLeod hält diesen Anspruch nicht für vermessen. „Bei den Olympischen Spielen ist jeder Gegner hart, aber wir hatten eine sehr gute Vorbereitung. Für uns ist zwar schon die Qualifikation ein wichtiger Schritt gewesen, aber ich glaube, dass hier viel möglich sein wird, wenn wir ins Rollen kommen“, sagt der Bundestrainer, der mit seinem Team eine interessante Gemeinsamkeit teilt. Nicht nur für die 23 Spielerinnen seines Aufgebots, sondern auch für ihn sind es die ersten Olympischen Spiele. „Ich hatte immer den Traum, es zu Olympia zu schaffen, am liebsten natürlich als Spieler“, sagt der frühere Verteidiger, der in der Deutschen Eishockey-Liga zwischen 1997 und 2004 für die Kassel Huskies auflief. „Nun als Trainer dabei zu sein, erfüllt mich auch mit Stolz und Freude, ich bin sehr gespannt auf alles, was ich erleben werde!“
27. Januar 2026: Demokratie verteidigen - Lernen aus der Geschichte des Sports
Die Rolle des Sports im NS
Die NS-Diktatur hat sich den Sport auf unterschiedliche Weise zu Nutze gemacht: Sport diente dazu, die Arbeitsmoral und Kriegstüchtigkeit zu steigern und die Freizeitgestaltung zu normieren.
Besonders zynisch zeigte sich die Rolle des Sports in den Konzentrationslagern. Einerseits sollte er dort für die Unterhaltung der KZ-Aufseher sorgen, gleichzeitig war der Sport Vernichtungsinstrument - unterernährte Menschen wurden zu Leibesübungen gezwungen, bis sie vor Erschöpfung zusammenbrachen. Und nicht zuletzt diente er als Propagandamittel. Die Olympischen Spiele vor 90 Jahren waren ein Paradebeispiel dafür, wie die Nazis sportliche Großereignisse dafür nutzten, ihre Macht zu demonstrieren und ihre Ideologie zu verankern - auch über die Landesgrenzen hinaus. In “Vorbereitung” der Sommerspiele 1936 in Berlin wurden nicht nur Hunderte Antifaschist*innen verhaftet, um Protestaktionen zu verhindern. Es wurden außerdem rund 600 Sinti*zze und Rom*nja von der Polizei aus ihren Wohnungen und Wohnwagen geholt und in das Zwangslager Marzahn deportiert, welches später als Sammelstelle für Deportationen in Konzentrationslager wie Auschwitz diente. Damit wurden die Olympischen Spiele auch als Vorwand zur Umsetzung der rassistischen Verfolgungspolitik des NS-Regimes genutzt.
Sport damals - unpolitisch?
Wie nahezu alle gesellschaftlichen Bereiche hat sich auch der Sport dem politischen System des Nationalsozialismus teils bereitwillig untergeordnet. Die Vielfalt an Sportverbänden, die sich einst aus jüdischen, konfessionellen, bürgerlichen und Arbeiter*innenverbänden zusammensetzte, wurde ausgedünnt und gleichgeschaltet. Widerstand kam fast ausschließlich aus den Arbeiter*innenvereinen, wobei viele Sportler*innen bereits 1933 inhaftiert und einige von ihnen ermordet wurden.
So enthoben Sportvereine teilweise in vorauseilendem Gehorsam jüdische Spieler ihrer Ämter und schlossen sie aus dem Verein aus. Dabei wurden gerade bestimmte Sportarten, wie der Fußball, vielfach durch Juden in Deutschland etabliert - nicht zuletzt durch Walter Bensemann, Gründer des Kickers und Mitbegründer des DFB.
Das Ehrenamt: Ein Schatz, den wir unbedingt bewahren müssen
Ich bin, und das sage ich voller Dankbarkeit für das, was mich geprägt hat, ein Kind des Vereinssports. Früher aktive Basketballerin bei der Turngemeinde Hanau und bis heute Mitglied im 1. Hanauer Tennis- und Hockeyclub - ein Leben ohne Sport im Verein war und ist für mich nicht vorstellbar. Unser Vereinssystem ist weltweit einzigartig. Neulich sprach ich mit einer Frau, die nach Deutschland zugewandert ist und mir ungläubig erzählte, wie überrascht sie war, dass es in Deutschland die Möglichkeit gibt, für vergleichsweise kleines Geld - Kinder zahlen im Schnitt vier Euro Beitrag pro Monat - Mitglied in einem Verein zu werden, in dem man jede Sportart ausüben darf, auf die man Lust hat. Ja, dachte ich, das ist tatsächlich großartig. Und dann wurde mir wieder einmal klar, wie wenig uns oftmals bewusst ist, was für einen Schatz wir damit besitzen!
Dieser Schatz allerdings droht an Wert zu verlieren, womit ich bei meinem beruflichen Lebensthema bin: dem Ehrenamt. Im Mai vergangenen Jahres hat uns der Sportentwicklungsbericht mit diversen Fakten konfrontiert, von denen besonders einer mich aufgerüttelt hat. Mehr als jeder sechste der rund 86.000 Sportvereine in Deutschland sieht seine Existenz dadurch bedroht, dass es zu wenig Personal gibt, das ehrenamtlich wichtige Aufgaben übernehmen kann oder möchte. Das ist eine Tendenz, die in ihrer drastischen Ausprägung neu ist, und die uns alle betrifft. Deshalb möchte ich dazu ein paar einordnende Sätze verlieren.
Ich bin nicht nur ein Kind des Vereinssports, sondern im DOSB auch eine Wegbegleiterin der ersten Stunde. 1995 habe ich in der Vorgängerorganisation Deutscher Sportbund, der 2006 mit dem Nationalen Olympischen Komitee zum DOSB fusionierte, die erste Stelle mit Zuständigkeit für Sport und Gesundheit besetzen dürfen. Später verantwortete ich das Thema Ehrenamt. Ich weiß deshalb aus eigener Erfahrung, dass früher beileibe nicht alles besser war. Auch damals wurden Menschen, die sich freiwillig und ohne Anspruch auf Entlohnung für den Sport engagierten, manchmal händeringend gesucht. Was sich jedoch verändert hat über die vergangenen 20 Jahre: Früher war es einfacher, solche Menschen zu finden.
Das Leben hat sich stark verdichtet
Allerdings waren damals die Lebensumstände andere. In meinen Sportvereinen waren die Vereinsvorsitzenden ältere Männer, die nach der Arbeit ihrem Amt im Sport nachgingen, während die Frauen ihnen daheim den Rücken freihielten. Die Lebensrealitäten haben sich verändert, wir sprechen gemeinhin von einer Verdichtung des Lebens, sehr viele Menschen geben an, weniger Zeit zu haben als früher. Ob dem tatsächlich so ist, sei einmal dahingestellt. Es gibt Studien, die aufzeigen, dass die Zeit schlicht anders als früher genutzt wird und wir eigentlich mehr Zeit denn je haben. Nur nutzen viele diese leider nicht mehr für ein Ehrenamt. Insbesondere der Medienkonsum ist exorbitant gestiegen, was wohl jeder und jede von uns auch an sich selbst beobachten kann.
Deutlich widersprechen möchte ich der verbreitet vorgetragenen These, dass das ehrenamtliche Engagement und der Zusammenhalt der Gesellschaft im Allgemeinen nachgelassen haben. Was wir stattdessen feststellen und im Freiwilligensurvey auch nachlesen können: Knapp 30 Millionen Menschen in Deutschland haben mindestens ein Ehrenamt, gut neun Millionen davon entfallen auf den Sport. Und es besteht auch unter den Menschen, die sich bisher nicht engagieren, eine hohe Bereitschaft für ein Engagement. Aus einer repräsentativen Studie, die das Leibniz-Institut für Medienforschung sowie das Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt und mindline media gemeinsam mit ARD, ZDF und Deutschlandradio im Frühjahr 2025 durchgeführt haben, geht hervor, dass der Sport den mit Abstand wichtigsten Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt leistet. Auch der Sportentwicklungsbericht zeigt, dass im Selbstverständnis der Sportvereine das Gemeinschaftsgefühl, Solidarität und die demokratische Beteiligung die wichtigsten Werte darstellen.
Problematisch ist der Bereich des langfristigen Engagements
Verändert hat sich allerdings die Verteilung der geleisteten Arbeit. Wir haben im Sport grundsätzlich kein Problem, für kurzfristige Projekte wie Großveranstaltungen, die zeitlich begrenzt sind, ausreichend helfende Hände zu finden. Problematisch ist der Bereich des langfristigen Engagements. Hier verteilt sich zunehmend mehr Arbeit auf weniger Schultern, und genau dieser Fakt ist es, der den Vereinen Existenzsorgen bereitet. Aus anderen gesellschaftlichen Bereichen heißt es oft, der Sport müsse mehr anderes Engagement anbieten, sich im Ehrenamt moderner aufstellen. Aber so einfach ist das nicht: Vereinsvorsitzende können nicht alle drei Monate ausgetauscht werden. Das zentrale Ziel eines Sportvereins ist es, dass Menschen eine Sportart erlernen und Bewegungskompetenzen erwerben. Damit einher geht nicht nur das Lernen von technischen und taktischen Fertigkeiten, sondern auch eine Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit. Auch bauen Sportler*innen Selbstbewusstsein und Selbstdisziplin auf, lernen mit Erfolg und Niederlagen umzugehen. Trainer*innen und Übungsleiter*innen übernehmen eine zentrale Rolle in dieser Entwicklung – und dies tun sie in überwiegender Zahl ehrenamtlich. Solche Lernprozesse erfolgreich zu begleiten, braucht ein kontinuierliches Engagement. Wir brauchen also diejenigen, die sich langfristig dazu bereiterklären, ihre Freizeit zu opfern.
Dabei negieren wir im DOSB natürlich nicht, dass sich auch der organisierte Sport bewegen muss. Ein Beispiel, das einen Weg dahin aufzeigt, hat sich jüngst in Hamburg aufgetan. Moritz Fürste, zweimaliger Olympiasieger im Feldhockey und Miterfinder der neuen Fitnesssportart Hyrox, hat bei seinem Heimatverein Uhlenhorster HC das Präsidentenamt übernommen. Das war aber nur möglich, weil er die Aufgaben, die bislang der Vereinsvorsitzende Horst Müller-Wieland allein übernommen hatte, auf acht Mitstreiter*innen verteilt hat. So wird aus einem zeitintensiven Amt eine Art Jobsharing, in dem eine Gruppe von Menschen die anfallenden Aufgaben ehrenamtlich stemmen kann. Ich finde diese Art der Problemlösung vorbildlich, bin mir aber durchaus bewusst, dass es dafür einer Galionsfigur wie Moritz, der übrigens auch Persönliches Mitglied im DOSB ist, und einer motivierten Gruppe bedarf, die gemeinsam Lust am Gestalten hat.
„Ich liebe es, anzupacken und etwas zu verändern“
Einmal, nur ein einziges Mal hat sie sich gefragt, ob sie den richtigen Weg eingeschlagen hat. 2017 war das, als Mareike Miller im Deutschen Rollstuhl-Sportverband als Nachfolgerin für die damalige Athletensprecherin Marina Mohnen kandidierte, und jemand zu ihr sagte, dass sie doch sowieso die Einzige sei, die sich so ein Amt antun würde. „Da habe ich schon kurz überlegt, warum so eine Aussage kommt“, erinnert sich die 35-Jährige, die sich damals nicht beirren ließ und ihr erstes sportpolitisches Ehrenamt antrat. Zum Glück, wie wir heute wissen, denn seit dem 6. Dezember 2025, als sie von der Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes bestätigt wurde, zählt Mareike Miller als gewählte Vertreterin der Athlet*innen zum DOSB-Präsidium, sie hat Marathonläuferin Fabienne Königstein ersetzt und ist die erste aktive paralympische Sportlerin, die den Schritt ins Präsidium gegangen ist.
Dass sie überhaupt gehen kann, überrascht bis heute viele Menschen. „Wer mich nicht kennt, erwartet natürlich nicht, dass eine Fußgängerin kommt, wenn eine Rollstuhlbasketballerin angekündigt ist. Da gibt es immer wieder viel Erklärungsbedarf“, sagt die Paralympicssiegerin von 2012, die 2016 in Rio de Janeiro zudem Silber gewann und auch 2021 in Tokio und 2024 in Paris zum Kader der deutschen Frauen zählte. Stören tut sie das nicht, obwohl sie sich schon wünschen würde, dass zumindest unter Sportfans geläufiger wäre, dass ein Sportrollstuhl genauso ein Sportgerät ist wie ein Tennisschläger oder ein Ruder. „Ein Mitspieler von mir hat mal gesagt, dass der Rollstuhl für uns so ist wie das Paar Turnschuhe für Hallensportler, wir schlüpfen dort genauso hinein und nutzen ihn nur für Training oder Wettkampf.“
Zur Erklärung: Im Rollstuhlbasketball werden die Teammitglieder gemäß ihrer Einschränkungen bepunktet, die Punkte reichen von 1 bis 4,5, die Gesamtpunktzahl im Team darf 14 nicht überschreiten. Mareike, die ursprünglich „Fußgänger-Basketball“ spielte und wegen ihrer bis zum 18. Geburtstag erlittenen vier Kreuzbandrisse als Sportinvalidin gilt, ist mit 4,5 Punkten klassifiziert. „Ich wurde also in den Rollstuhlsport inkludiert und habe seitdem aus eigener Erfahrung heraus ein Faible für das Thema Inklusion“, sagt sie. Aber auch Geschlechtergerechtigkeit und das Schaffen eines professionellen Umfelds für Athlet*innen sind Felder, die sie seit acht Jahren mit viel Energie beackert.
Seit 2017 engagiert sie sich in sportpolitischen Ämtern
Die Lust daran, sich für die Allgemeinheit zu engagieren, sei bei ihr früh entstanden. „Ich habe mich schon immer dafür interessiert, warum Dinge so funktionieren, wie sie funktionieren. Ich bin ein neugieriger Mensch, der gern hinter die Kulissen schaut“, sagt sie. Der Weg durch die Gremien, den sie seit 2017 gegangen ist, erscheint ihr deshalb in der Rückschau auch nur logisch. Kurz nach der Wahl zur Athletensprecherin wurde sie in die Athletenkommission des Deutschen Behindertensport-Verbands (DBS) berufen, 2020 zur Gesamt-Aktivensprecherin gewählt. Ein Jahr später kandidierte sie erfolgreich für das Präsidium von Athleten Deutschland, 2022 wurde sie in ihrer DBS-Rolle in die Athlet*innenkommission des DOSB kooptiert. Und nun, im Januar 2026, hat sie gerade eine Woche Praktikum hinter sich gebracht, um am DOSB-Hauptsitz in Frankfurt am Main die Strukturen und Abläufe im Dachverband des organisierten Sports besser verstehen zu lernen.
Sie nahm in der vergangenen Woche an der Vorstandssitzung teil, in der die 188 Athlet*innen für die Olympischen Winterspiele in Norditalien (6. bis 22. Februar) nominiert wurden. Sie erfuhr im Games Management, warum Großereignisse mit mehreren Jahren Vorlauf geplant werden müssen. Sie konnte den Vorstandsvorsitzenden Otto Fricke begleiten und Gespräche mit den Vorständen Michaela Röhrbein (Sportentwicklung), Thomas Arnold (Finanzen) und Leon Ries (Jugend) führen. Die Ressortleiterinnen Eva Werthmann (Verbandskommunikation) und Peggy Bellmann (Diversity) erläuterten ihre Tätigkeitsfelder, Laura Hohmann-Kießler und Ruben Göbel erklärten ihr das wissenschaftliche Verbundsystem. Alexander Best, Leiter des Exekutivbüros, stand ebenso Rede und Antwort wie Folker Hellmund, Direktor des Brüsseler EOC-EU-Büros. „Ich habe jetzt einen guten Überblick bekommen und mehr Verständnis für die Komplexität des DOSB gewonnen. Das waren wertvolle Einblicke für mich“, sagt sie.
Die Turngemeinde Herford von 1860 gewinnt den „Großen Stern des Sports“ in Gold
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Elke Büdenbender überreichten die bedeutendste Auszeichnung für gesellschaftliches Engagement von Sportvereinen in Deutschland gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), Otto Fricke, und der Präsidentin des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), Marija Kolak. Darüber hinaus erhielt der Verein aus Nordrhein-Westfalen im Rahmen der feierlichen Preisverleihung am Montag (26. Januar) in der DZ BANK in Berlin für diesen herausragenden Erfolg ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro.
Das Ehrenamt neu denken und nachhaltig stärken
Die Turngemeinde Herford von 1860 überzeugte mit ihrer Initiative „Vereinsheld 2025 - Unsere Zukunft ist Ehrenamt“, mit der sie eine umfassende Kampagne gestartet hatte, um das Ehrenamt neu zu denken und nachhaltig zu stärken. „Die Initiative basiert auf sechs Säulen - von monatlichen Netzwerktreffen und einer eigenen Heldenakademie über Qualifizierungsformate bis hin zum innovativen NextGen-Stipendium, das junge Engagierte ab 13 Jahren finanziell und persönlich fördert“, so Frederick Humcke aus dem Vereinsvorstand der TG Herford. „Ziel ist es, Engagement sichtbarer, attraktiver und zukunftsfähiger zu machen: durch Wertschätzung, Weiterbildung und echte Beteiligung.“ Mit seinem modularen Aufbau, den starken Partnernetzwerken und der Kombination aus sozialer Verantwortung, Förderung und Partizipation schafft das Engagement eine moderne Ehrenamtskultur mit Vorbildcharakter - in Herford und weit darüber hinaus. Das Projekt wurde über den gesamten Wettbewerbsverlauf von der Volksbank in Ostwestfalen begleitet.
Deutschland wählt Team D Fahnenträger*innen-Duo für Mailand Cortina
Der DOSB hat am Montag, 26. Januar, sechs Kandidat*innen - drei Frauen und drei Männer - für die Wahl zum Fahnenträger*innen-Duo bekanntgegeben.
Abgestimmt werden kann unter www.teamdeutschland.de.
Bekanntgegeben wird das gewählte Duo einen Tag vor der Eröffnungsfeier am Donnerstag, 5. Februar 2026, auf der Team D Pressekonferenz.
Der DOSB hat folgende sechs Mitglieder des Team Deutschland zur Wahl benannt (in alphabetischer Reihenfolge, getrennt nach Geschlecht):
Denise de Vries gewinnt den Publikumspreis der „Sterne des Sports“
Zum elften Mal haben der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und die Volksbanken und Raiffeisenbanken im Rahmen des Wettbewerbs „Sterne des Sports“ in Zusammenarbeit mit der ARD den Publikumspreis verliehen. Zur Abstimmung durch das Publikum des ARD-Morgenmagazins und die breite Öffentlichkeit standen drei Personen, die durch ihr besonderes persönliches Engagement für ihren Sportverein herausragten.
So kannst du die „Sterne des Sports“ live verfolgen
Das Bundesfinale der „Sterne des Sports“ wird live im Stream auf www.sportschau.de übertragen. Ab 10.25 Uhr können alle Interessierten die feierliche Verleihung der „Sterne des Sports“ in Gold direkt verfolgen.
Gemeinsam mit dem Deutschen Olympischen Sportbund und den Volksbanken Raiffeisenbanken ehrt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beim 22. Bundesfinale Sportvereine aus ganz Deutschland für ihr herausragendes gesellschaftliches Engagement. Insgesamt 17 Finalisten stehen im Mittelpunkt, die mit innovativen Ideen, besonderen Projekten und nachhaltiger Vereinsarbeit überzeugen konnten.
Die wichtigste Auszeichnung des Engagements im deutschen Sport überreichen Bundespräsident Steinmeier gemeinsam mit Otto Fricke, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Olympischen Sportbundes, sowie Marija Kolak, Präsidentin des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR).
Die Preisverleihung findet in der DZ BANK am Pariser Platz in Berlin statt und ist bundesweit live über die ARD im Stream zu sehen.
ARD-Livestream
Sportstättenförderung überzeichnet - Bedarf übersteigt Mittel um Vielfaches
Das Antragsportal für das neue Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ ist seit dem 16. Januar 2026 geschlossen. Drei Monate hatten Kommunen aus ganz Deutschland Zeit, um ihre Anträge für Projekte einzureichen.
Nun hat das zuständige Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) bekannt gegeben: Es gab über 3.600 Projektskizzen auf Förderung mit einer beantragten Gesamtfördersumme von mehr als 7,5 Milliarden Euro. Dem stehen aktuell 333 Millionen Euro an verfügbaren Bundesmitteln gegenüber. Damit ist das Programm in seiner ersten Phase rund 21-fach überzeichnet.
Diese Zahlen verdeutlichen eindrücklich den massiven Sanierungs- und Modernisierungsbedarf an Sportstätten in Deutschland - und den hohen Unterstützungsbedarf von Kommunen und Sportvereinen, um den bestehenden Sanierungsstau abzubauen.
Das Team D Mailand Cortina 2026 - Zahlen, Daten, Fakten
Team D Gesamtgröße
Das Team Deutschland für die Olympischen Winterspiele 2026 Mailand Cortina umfasst insgesamt 185 Athletinnen und Athleten. Ergänzt wird der Kader durch vier Ersatzathlet*innen. Somit ist es das größte Team Deutschland zu Olympischen Winterspielen, das es bisher gegeben hat. Der vorherige Rekord stammt von den Winterspielen Turin 2006 mit einer Mannschaftsgröße von 161 Athlet*innen.
Ein geschlechtergerechtes Team D Mailand Cortina 2026
Die Zusammensetzung des Teams ist nahezu geschlechtergerecht: 86 Athletinnen, entsprechend 46 Prozent, sowie 99 Athleten mit einem Anteil von 54 Prozent wurden nominiert. Zusätzlich stehen zwei Ersatzathletinnen und zwei Ersatzathleten zur Verfügung.
Erfahrung im Team D
Im Team D treffen zahlreiche Newcomer und olympische Erfahrung aufeinander. Insgesamt 73 Athlet*innen (39 Prozent), haben bereits an Olympischen Spielen teilgenommen. Demgegenüber stehen 112 Athlet*innen (61 Prozent), die in Mailand Cortina 2026 erstmals olympische Luft schnuppern.
Medaillen im Gepäck des Team D
Zum Team Deutschland gehören 37 Medaillengewinner*innen, die in ihrer bisherigen Karriere gemeinsam 67 olympische Medaillen errungen haben. Mit 36 Gold-, 24 Silber- und sieben Bronzemedaillen im Gepäck reist das Team D nach Italien.
Die verschiedenen Sportarten des Team D
Team Deutschland ist bei den Olympischen Winterspielen 2026 in insgesamt 15 Sportarten vertreten. Das zahlenmäßig größte Aufgebot stellt das Eishockey mit 48 Athlet*innen. Es folgen die Snowboarder*innen mit 19 sowie der Bobsport mit 18 Athlet*innen. Die wenigsten Athlet*innen gehen mit jeweils drei in der Nordischen Kombination sowie im Skibergsteigen für Deutschland an den Start.
Team D Athlet*innen nach Bundesländern
Die Athlet*innen des Team Deutschland stammen aus Sportvereinen aus verschiedensten Bundesländern sowie aus dem internationalen Umfeld. Den größten Anteil stellt Bayern mit 82 Athlet*innen, gefolgt von Baden-Württemberg mit 24 und Thüringen mit 18. Aus den weiteren Bundesländern kommen insgesamt 43 Athlet*innen, darunter Sachsen mit 15, Berlin mit 11 und Nordrhein-Westfalen mit 7 Athlet*innen. Darüber hinaus sind 18 Athlet*innen aus dem Eishockey internationalen Sportvereinen zugeordnet in Kanada, Schweden, der Schweiz und den USA.
Erfolgreichste Team D Athlet*innen bei Olympischen Spielen
Zu den erfolgreichsten Athlet*innen im Team Deutschland Mailand Cortina 2026 zählen Tobias Arlt und Tobias Wendl, die im Rennrodeln gemeinsam sechs olympische Goldmedaillen gewonnen haben. Ebenfalls zu den herausragenden Medaillensammlern gehören Bobpilot Francesco Friedrich und Anschieber Thorsten Margis mit jeweils vier Goldmedaillen. Felix Loch, ebenfalls im Rennrodeln aktiv, bringt drei Goldmedaillen mit, während Skispringer Andreas Wellinger in seiner bisherigen olympischen Karriere zwei Gold- und zwei Silbermedaillen errungen hat.
Olympia-Rekordteilnehmer*innen des Team D
Gleich mehrere Athlet*innen des Team Deutschland blicken auf eine lange olympische Laufbahn zurück:
- Felix Loch im Rennrodeln, Johannes Rydzek in der Nordischen Kombination sowie Patrick Beckert im Eisschnelllauf nehmen in Mailand Cortina 2026 bereits zum fünften Mal an Olympischen Spielen teil.
- Ihre vierte olympische Teilnahme absolvieren in Italien insgesamt 9 Athlet*innen, darunter Francesco Friedrich und Thorsten Margis im Bobsport, Toni Eggert im Rennrodeln und Franziska Preuß im Biathlon.
- Ihre dritten Olympischen Spiele bestreiten insgesamt 15 Athlet*innen, darunter Andreas Wellinger und Juliane Seyfarth im Skispringen, Vinzenz Geiger in der Nordischen Kombination, Lena Dürr im Ski Alpin und Ramona Hofmeister im Snowboard.
Die ältesten / jüngsten Team D Athlet*innen
Die Altersstruktur des Team Deutschlands reicht von jugendlichen Nachwuchstalenten bis zu sehr erfahrenen Routiniers. Jüngste Athletin ist die Eishockeyspielerin Mathilda Heine, die zum Start der Olympischen Spiele 16 Jahre alt ist. Der jüngste Athlet ist der Eisschnellläufer Finn Sonnekalb, der zu diesem Zeitpunkt 18 Jahre alt ist. Als älteste Athletin geht die Skispringerin Juliane Seyfarth an den Start, die während der Spiele ihren 36. Geburtstag feiern darf. Der älteste Athlet im Team ist Eishockeyspieler Moritz Müller, mit 39 Jahren.
Stabil in Knie und Kopf: Muriel Mohr ist bereit für ihre Olympiapremiere
Als am Montagnachmittag in der Mixed Zone, in der die Medien die Athletinnen und Athleten des Team D zur Einkleidung und ihren Zielen für die Olympischen Winterspiele in Norditalien befragen, ein Dutzend Kameras und Mikrofone auf sie gerichtet sind, sagt Muriel Mohr einen Satz, der nachhallt. „Ich kann jetzt wieder alles, was ich können möchte.“ Eine Aussage ist das, die wohl jeder Mensch gern über sich treffen würde. Die 19-Jährige hat sie zwar darauf bezogen, dass sie nach ihrem bei der WM 2025 erlittenen Kreuzbandriss im linken Knie wieder vollkommen genesen ist. Aber die Art und Weise, wie Deutschlands Medaillenhoffnung im Ski Freestyle in der MTC World of Fashion in München das gesamte Frage-Antwort-Spiel meistert, lässt zumindest darauf schließen, dass es ihr an Selbstvertrauen nicht mangelt vor ihrer Olympiapremiere.
Dass sie diese als aktive Athletin erleben würde, war lange Zeit unsicher. Ein Kreuzbandschaden ist immer eine kapitale Verletzung; in einem Sport wie ihrem, in dem sie im Slopestyle durch einen Hindernisparcours manövriert, im Big Air komplexe Einzelsprünge absolviert und dabei stets festen Halt auf den Brettern suchen muss, ist das Knie aber extrem belastet. Dennoch war der Glaube daran, es nach Livigno, wo die Wettkämpfe im Ski Freestyle ausgetragen werden, schaffen zu können, immer da. „Olympia war immer das Ziel, der Ausblick darauf hat mir geholfen, stabil und motiviert zu bleiben. Außerdem hatte ich das beste Team, das mich immer wieder aufgebaut hat“, sagt die Studentin der Gesundheitswissenschaften, die sich im Sommer, als an Sport noch nicht zu denken war, kurioserweise für die Uni viel damit beschäftigte, wie Kreuzbänder zusammengeflickt werden.
Sportpsychologe half bei der Verarbeitung der Verletzung
Geholfen habe ihr zudem die Arbeit mit ihrem Sportpsychologen, der ihr mit dem Aufbau von Routinen, Visualisierungen und Anleitung zu positivem Denken wichtige Unterstützung leistete. „Mit ihm habe ich auch vor der nationalen Qualifikation telefoniert, er hat mir Mut zugesprochen und Vertrauen gegeben“, sagt die Athletin vom Kirchheimer SC, die am vergangenen Wochenende beim Weltcup in Laax (Schweiz) das Ticket für die Winterspiele perfekt machte. „Das war natürlich eine Erleichterung“, sagt Muriel, die auch mental keinerlei Überbleibsel der schweren Verletzung spürt. „Respekt ist immer da, das ist in einer Risikosportart wie unserer auch wichtig. Aber Angst, dass das Knie nicht hält, habe ich keine. Wir leben mit einem gewissen Verletzungsrisiko, aber ich habe die Challenge gut gemeistert und fühle mich bereit“, sagt sie.
Bereit, sich Herausforderungen zu stellen, ist Muriel Mohr tatsächlich schon seit Kindertagen. Schon als Zweijährige fuhr sie mit ihrem Vater im Tiefschnee Ski, „da bin ich über jeden Kicker hinter ihm hergefahren“, erinnert sie sich. Ihre aktive Sportkarriere startete die aus dem Münchner Osten stammende Allrounderin, die im Sommer gern Rennrad und Mountainbike fährt und kiten geht, allerdings im Ballett - einem Sport, der in puncto Körperbeherrschung und Ausdrucksstärke durchaus eine wichtige Grundlage für Freestyler*innen legt. Mit neun Jahren kam sie auf einer Jugendreise mit dem Freestyle in Kontakt, ein Jahr später entdeckte sie der heutige Bundestrainer Jiri Volak und formte sie zu einer der weltbesten Juniorinnen.